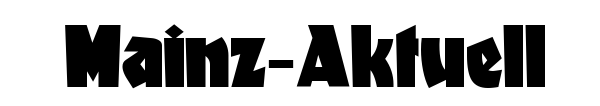Die Stimmung und das Willkommensgefühl gegenüber Geflüchteten in Deutschland haben sich laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) seit 2015 verändert. Im Jahr 2020 fühlten sich nur noch 78 Prozent der Befragten willkommen, während es 2017 noch 84 Prozent waren. Bis 2023 sank dieser Wert auf 65 Prozent. Diskriminierungserfahrungen hängen unter anderem vom Bildungsstand und Geschlecht ab. Es gibt eine wachsende Sorge vor Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass in der Gesellschaft.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in konkreten Zahlen wider: Im Jahr 2020 gaben nur noch 78% der Geflüchteten in Deutschland an, sich willkommen zu fühlen, im Vergleich zu 84% im Jahr 2017. Besonders besorgniserregend ist, dass 54% der Befragten im Jahr 2023 Angst vor Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass in Deutschland haben.
Die Studie verdeutlicht zudem, dass Diskriminierungserfahrungen stark vom Bildungsstand und Geschlecht abhängen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einbürgerung von Geflüchteten: 98% der Befragten planen, sich einbürgern zu lassen, was zeigt, dass trotz der wachsenden Sorgen die Integration in die deutsche Gesellschaft ein wichtiges Ziel bleibt.
Besonders alarmierend sind die Ergebnisse bezüglich der Entwicklung von Kindern Geflüchteter. Laut der Studie zeigen diese Kinder in Bereichen wie Sprache, sozialen Beziehungen und motorischen Fähigkeiten im Vergleich zu Kindern anderer Mütter deutliche Defizite. Diese Unterschiede sind ein wichtiger Hinweis auf die Herausforderungen, vor denen geflüchtete Familien stehen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die öffentliche Debatte über migrationspolitische Maßnahmen einen direkten Einfluss auf das Willkommensgefühl gegenüber Geflüchteten in Deutschland hat. Trotz steigender Sorgen über Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung sind die meisten Geflüchteten nicht abgeneigt, in Deutschland zu bleiben und sich einzugliedern. Die Zukunft der Kinder Geflüchteter ist eng mit Faktoren wie der mentalen Gesundheit der Mutter und ihrem Bildungsstand verbunden, was die Bedeutung ganzheitlicher Unterstützungsmaßnahmen für diese Familien unterstreicht.